« 18.02.05 | Startseite | 20.03.05 »
19.02.05
14:50
Die Bären: Preise der Internationalen Jury
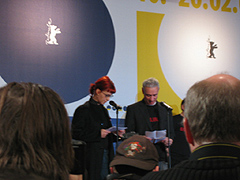
So richtig zufrieden sahen Roland Emerich und Franka Potente nicht aus, als sie die Preise verkündeten. Der beste Film schien ein Kompromiss. Bei Publikum und Presse war ganz klar der politische Film Paradise Now der Favorit. So gab es bei Bekanntgabe des goldenen Bärens vereinzelt die üblichen Buh-Rufe.
Und hier die Gewinner:
Goldener Bär
U-Carmen eKhayelitsha (Südafrika) von Mark Dornford-May
Jury Grand Priz-Silbener Bär
Kong Que/Peacock (VR China)von Gu Changwei
Silbener Bär - Beste Regie
Marc Rothemund für Sophie Scholl - Die letzten Tage (Deutschland)
Silbener Bär - Beste Darstellerin
Julia Jentsch für Sophie Scholl - Die Letzten Tage (Deutschland)
Silbener Bär - Bester Darsteller
Lou Taylor Pucci für Thumbsucker.
Silberner Bär - Künstlerische Leistung
Tsai Ming Liang für das Drehbuch zu Tian Bian Yi Duo Yun/The Wayward Cloud (Taiwan/Frankreich)
Silberner Bär - Beste Filmmusik
Alexandre Desplat für De Battre Mon Coeur S´est Arrete/The Beat That My Heart Skipped (Frankreich)
Alfred-Bauer-Preis
(In Erinnerung an den Gründer der Berlinale, für einen Film, "der neue Perspektiven der Filmkunst" eröffnet)
Tian Bian Yi Duo Yun/The Wayward Cloud (Taiwan/Frankreich) von Tsai Ming Liang
Der Blaue Engel - (Bester europäischer Film)
Paradise Now (Niederlande, Frankreich, Deutschland)von Hany Abu-Assad
Autor: andreas 19.02.05 14:50 | Kommentare (0)
14:00
Die Preise der Unabhängigen
In dem gediegenen Ambiente der Saarländischen Landesvertretung wurden die Preise der Unabhängigen bekannt gegeben. Fast hatte man das Gefühl, auf der Berlinale konkurrieren nicht nur die Filme sondern auch Preise.
Innerhalb von einer Stunde mussten zehn Preise vergeben werden (und das waren noch nicht einmal alle).

Preisvergabe-Akkord: ein ständiges Kommen und gehen
Hier ein Aussschnitt aus der Preisvielfalt:
(die komplette Übersicht gibt es auf der Berlinale Seite)
Preise der Ökumenischen Jury
Bester Film im Wettbewerb: Sophie Scholl von Marc Rothemund

Rothemund nimmt den Preis der Ökumenischen Jury entgegen
Bester Film in der Sektion Panorama: Va, Vis Et Deviens (Live and Become) von Radu Mihaileanu
Bester Film in der Sektion Forum: RatzitiLIhiyot Gibor/On the Objection Front von Shiri Tsur
Panorama Publikumspreis
Va, Vis Et Deviens (Live and Become) von Radu Mihaileanu
Teddy Awards
Bester Spielfilm: Un Año Sin Amor von Anahí Berneri
Bester Dokumentarfilm: Katzenball von Veronika Minder
Preise des Internationalen Verbands der Filmkritik („Fédération Internationale de la Presse Cinématographique“)
Wettbewerb: Tian Bian Yi Duo Yun/The Wayward Cloud von Tsai Ming-Liang
Panorama: Massaker von Monika Borgmann, Lokman Slim, Hermann Theißen
Forum: Nui Piu/Oxhide von Liu Jiayin
Dialogue en perspective
(TV5 und Deutsch-Französischen Jugendwerk für einen herausragenden Beitrag in der Sektion Perspektive Deutsches Kino)
Netto von Robert Thalheim
Leserjury-Preises der Berliner Morgenpost
Paradise Now von Hany Abu-Assad
Amnesty International Filmpreis
Paradise Now von Hany Abu-Assad

Hany Abu-Assad mit dem ai-Preis. Besonders freute ihn der Leserjury Preis der Morgenpost, denn das zeige, dass sein Film vom Publikum angenommen werde.
Autor: andreas 19.02.05 14:00 | Kommentare (0)
12:40
Kosslick IV, die Berlinale endet morgen. Zwei Zeitungsreviews
"Eine Schande für das Land" findet die FAZ den Umgang mit Filmen:
Nach Ende der Berlinale werden diese Filme, vor allem die zahlreichen erschütternden, bemerkenswerten, lehrreichen oder mindestens interessanten Dokumentarfilme, die im Festival zu sehen waren, in keinem deutschen Kino zu finden sein, sowenig wie die kleinen Produktionen aus China, der Mongolei, der Ukraine, Kroatien oder Korea oder die Kurzfilme, die die langen Spielfilme nicht selten durch ihren Witz und ihr technisches Raffinement ausstachen. Kurz, die zehn Tage der Berlinale sind die einzige Zeit im Jahr, in der sich das Kino in Deutschland als ernstzunehmende, wichtigste, entsprechend gepflegte und angemessen präsentierte populäre Kunstform behauptet. Für das Festival ist das Grund genug, stolz zu sein. Für das Land ist es eine Schande.Die Filmfestspiele in Berlin zeigen, daß der erbärmliche Zustand der deutschen Kinokultur, die Monotonie des Programms, die Verwahrlosung vieler Kinosäle, die oft unzureichende Projektion oder wummernde Klangqualität sich nicht damit erklären lassen, daß das Publikum sich vom Kino abgewandt habe und, wenn es sich doch einmal zum Kinobesuch aufraffe, nichts sehen wolle als Mainstreamware. Die Berlinale ist ein Zuschauerfestival. Sie gibt also auch Auskunft über das öffentliche Interesse am Medium und an der Aktivität „Ins Kino gehen”. (der ganze Artikel hier)
Die FR meint: Man muss kein Prophet sein, um die chancenreichen Kandidaten auf die Bären zu benennen: Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Marc Rothemunds dem alten Hauff-Film Stammheim gar nicht so unähnliche Aktenverfilmung Sophie Scholl nicht prämiert würde, wenigstens für ihre lebendige Mitte, die allseits zu recht bewunderte Hauptdarstellerin Julia Jentsch.
Autor: christian 19.02.05 12:40 | Kommentare (0)
12:10
El Inmortal - von Mercedes Moncada Rodríguez
Regie: Mercedes Moncada Rodríguez * Drehbuch: Mercedes Moncada Rodríguez *
Kamera: Javier Morón Tejero * Schnitt: Viviana Garcia, Mercedes Moncada Rodríguez

Etwas langatmig und betont symbolhaft, aber gute Dokumentation einer Familie im Bürgerkrieg
Der von den USA in Nicaragua gegen die gewählte Regierung der Sandinisten initiierte und unterstützte Krieg war in den 80er Jahren wohl eines der großen Thema der Linken in Europa. Wie skrupellos und teilweise vollkommen ohne politische Motivation viele Nicaraguaner dabei selbst gegeneinander vorgingen, dokumentiert Mercedes Moncada Rodríguez in diesem Film über eine bäuerliche Familie aus Nicaragua, die bei einem Scharmützel zwischen Sandinisten und Contras zwei Söhne und eine Tochter durch Entführung an die Contras verlor. Der einzige "verbliebene" Sohn hat sich später den Sandinisten angeschlossen und damit quasi gegen seine Geschwister gekämpft. Drei dieser Geschwister (der älteste Bruder ist im Krieg gestorben) erzählen mit ihrer Mutter von den damaligen Erlebnissen.
Dabei kommen hauptsächlich die von den Contras entführten beiden Geschwister zu Wort, was auch prompt im Zuschauergespräch moniert wurde - wo sei denn der Standpunkt der Sandinisten? Aber dem Film geht es garnicht im die politischen Positionen, sondern viel einfacher, um die Praxis der Kindesentführung, Ausbildung und des Kampfes. Denn, so erschreckend es war, die drei Geschwister zeigten sich auch heute noch weitgehend unpolitisch.
Die Beteiligten erzählen meist in ruhiger Stimme, was vorgefallen war, ihre Erinnerungen sind präzise und werden lebendig vermittelt. Viele der grauenhaften Konsequenzen des Krieges werden dabei allerdings nur angedeutet: etwa die Vergewaltigungen der (auch kämpfenden) Frauen, die Brutalität, mit der Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden (Geschwister durften eigentlich nicht zusammen kämpfen, denn es galt: wenn der eine stirbt, stirbt auch der andere, weil er immer versuchen wird, seinen Bruder oder seine Schwester zu retten).
Es ist ein interessantes Bild, das hier in geruhsamen und dicken Pinselstrichen von einem winzigen Dorf in Nicaraguagezeichnet wird. Etwas bemüht symbolisch quält sich ein bedrohlicher Lastwagen durch verschiedene Bilder, in dessen Windschutzscheibe "El Inmortal" geschrieben steht, der Unsterbliche. Er stehe für all das Übel und das Schlechte in Nicaragua, so die Regisseurin im Gespräch, das auch heute nicht verschwunden sei. Ihr Abschlussbild sei pessimistisch gemeint, aber der dann kaputte, von Pflanzen zugewachsene LKW wäre dann eher ein Symbol für Hoffnung? Vieles bleibt in diesem Film unklar. Unzweifelhaft aber ist, dass es Generationen benötigt, um die durch den Krieg Bruder gegen Bruder, Nachbar gegen Nachbar und Nicaraguaner gegen Nicaraguaner gerissenen Wunden wieder verheilen zu lassen. Das zeigt der Film eindrucksvoll.
Autor: dominik 19.02.05 12:10 | Kommentare (0)
11:50
Wettbewerb: Paradise now von Hany Abu-Assad
Niederlande, Frankreich, Deutschland 2005 Regie: Hany Abu-Assad * Darsteller: Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna Azabal, Amer Hlehel, Hiam Abbass

“Mit meinem Film kämpfe ich gegen die Besatzung und gegen das, was sie den Menschen antut“, sagt Hany Abu Assad, der Regisseur des viel beachteten Wettbewerbsbeitrags „Paradise now“. Was gibt es noch zu sagen über den Nahostkonflikt, womit kann sich ein Film jenseits der gängigen Klischees noch beschäftigen? Ich nicht längst alles gesagt, und sogar mehr als das? Abu Assad nimmt sich einem der umstrittensten Themen des Palästinakonflikts an, zu dem die Kunst in der Regel schweigt – wo sie es nicht tut, muss sie mit Skandalisierung oder dem Vorwurf der Naivität rechnen.
Als der schwedisch-israelische Künstler Dror Feiler in Stockholm Anfang 2004 ein Kunstwerk ausstellte, dass sich mit dem Thema beschäftigte, kam es zum Skandal. Unter dem Titel „Schneewittchen“ schwamm dort das Foto einer palästinensischen Selbstmordattentäterin auf einem Teich aus Blut; ein Begleittext enthielt Einzelheiten über die Biographie der Attentäterin. Das Werk zeigt mit den Mitteln der Groteske das Groteske der Tat. Aber nicht jeder Betrachter sah das Werk als Versuch, sich dem Phänomen der Attentäter anzunähern: Der israelische Botschafter war über das Gezeigte so erregt, dass er das Kunstwerk eigenhändig zerstörte. Ministerpräsident Sharon gratulierte ihm danach zu einem „mutigen Schritt gegen den Antisemitismus“.
Wer sich zum Thema äußert, begibt sich unvermeidbar auf vermintes Gelände. Hany Abu-Assad hat es trotzdem geschafft, einen relevanten Film über „Selbstmordattentate“ zu drehen – allein diese Feststellung macht den Film zu Recht nicht nur zu einem der politisch bemerkenswertesten, sondern wohl zu einem der wertvollsten Beiträge der diesjährigen Berlinale insgesamt. Er nähert sich dem umstrittenen Thema „Selbstmordattentate“ als menschlichem Phänomen und verweigert sich den gängigen Interpretationsmustern.
In der Regel gibt es zwei platte Erklärungen: Die eine – besonders in Israel populäre – Erklärung zeichnet die Attentäter als radikal indoktrinierte Mordmaschinen, deren religiöse Verblendung sie an den Eintritt ins Paradies nach vollbrachter Tat glauben lässt. Dieses Erklärungsmuster lässt keinen Platz für politische Motive, persönliche Verbitterung und das Gefühl der Demütigung. Die andere Erklärung, populär auch auf deutschen „Pro-Palästina-Demonstrationen“, macht es sich nicht weniger einfach: Allein die Besatzung sei schuld, die Grausamkeit der Israelis, die grenzenlose Verzweiflung und Armut der Palästinenser. Aber wer arm und verzweifelt ist, sprengt deswegen noch lange nicht unschuldige Menschen in die Luft.
Die ganze Diskussion um Selbstmordattentate ist ungeheuer politisch aufgeladen und wird auch meist sehr polemisch geführt. Abu-Assads völlig unpolemischer Film macht sich dagegen frei von einfachen Urteilen und pauschalen Argumenten. Er betrachtet im wesentlichen zwei Menschen, die sich zu einem Anschlag entschlossen haben und zeigt Kohärenz und Brüche in ihrer Haltung, in ihrer Biographie, in ihren Motiven und Überzeugungen. Dabei kommt es manchmal zu anrührenden, manchmal skurrilen Szenen, die dem Film nichts von seiner Glaubwürdigkeit nehmen. Den größten Wahnsinn fand Abu-Assad bei seinen Recherchen in der Realität; im Interview mit der „ZEIT“ erzählt er:
„Eine wirklich unglaubliche Geschichte handelt von einem Selbstmordattentäter, der zum Einsatz in Tel Aviv gefahren wird. Plötzlich steigt eine Frau zu ihm ins Auto. Es stellt sich heraus, dass sie ebenfalls einen Sprengstoffgürtel trägt. Daraufhin weigert er sich, den Auftrag mit ihr gemeinsam auszuführen, denn er ist davon überzeugt, dass das Töten Männersache ist, während die Frauen Leben schenken sollen. Beide werden furchtbar wütend und brüllen sich im Auto an. Sie beschimpft ihn als Frauenfeind, als Reaktionär, und sie besteht darauf, dass eine Frau das gleiche Recht hat, in den Tod zu gehen, wie der Mann. Das muss man sich mal vorstellen: Zwei Selbstmordattentäter in einem Riesenkrach über die Moderne, den Feminismus, die Geschlechterpolitik.“
Es sind solche krassen Brüche, die auch die Charaktere in Abu-Assads Film kennzeichnen. Sie sind weder gefühlskalte Monster noch religiös Fanatisierte, die vom sofortigen Eintritt in Paradies überzeugt sind. Es sind widersprüchliche Charaktere, deren Biographien stark von der Besatzung geprägt sind – was heute ohne Zweifel auf jeden jungen Palästinenser in der Westbank und besonders in Gaza zutrifft. Dabei macht es sich der Film nie so einfach, Selbstmordanschläge allein mit der schwierigen Lage der Palästinenser zu erklären. Aber er zeigt, dass das Gefühl der andauernden Erniedrigung, der Perspektivlosigkeit und des hergebrachten Hasses gegen „die Besatzer“ unabdingbare Grundvoraussetzungen sind. Die islamistischen Drahtzieher der Anschläge zeichnet Abu-Assad als Menschen, die hinter ihren Propagandaformeln kein menschliches Empfinden mehr bewahrt haben.
 Regisseur Hany Abu-Assad
Regisseur Hany Abu-Assad
Abu-Assad sagt von sich selbst, er sei „Pazifist“. Auch lässt der Film keinerlei Zweifel an der Tatsache, dass die Attentate moralisch falsch sind. Aber er nimmt die Motive der Attentäter ernst und versetzt sich in ihre Perspektive. Besonders das Ende von Abu-Assads Film ist dementsprechend wenig hoffnungsvoll. Es wäre einfacher gewesen, einen Film zu drehen, in dem alle Charaktere letztlich „bekehrt“ werden und zum gewaltlosen Widerstand übergehen. Dann wäre es ein Film geworden, der Hoffnung macht. Und ein Film, der sich der gegenwärtigen Realität verweigert.
Es wird auch bei diesem Film Stimmen geben, die Abu-Assad „Verständnis“ für die Selbstmordattentäter vorwerfen werden. Sollte er in Israel gezeigt werden, wird es lautstarke Proteste geben. Vielleicht wird wieder jemand versuchen, die Aufführung zu verhindern. Für Abu-Assad wäre das ein Erfolg: „Es wäre unglaublich, wenn die Isrealis einen Film sehen könnten, der Selbstmordattentäter als Menschen und nicht einfach als Monster porträtiert. Ich will Paradise Now aber auch in Nablus zeigen, wo wir viele Szenen gedreht haben. Leider gibt es dort kein Kino mehr...“
Autor: rene 19.02.05 11:50 | Kommentare (0)
11:35
Forum: Violent Days - von Lucile Chaufour
Regie: Lucile Chaufour * Drehbuch: Lucile Chaufour * Kamera: Dominique Texler * Schnitt: Elisabeth Juster * Darsteller: Frédéric Beltran, Franck Musard, Francois Mayet, Serena Lunn

Zwiespältig: Gute Musik, schöne Bilder, totale Leere
Vieles was Andreas in seiner Rezension über Ultranova geschrieben hat könnte man auch über Violent Days sagen. Auch hier ein Porträt von Langeweile, Leere, Ausweglosigkeit. Diesmal allerdings aus Frankreich und in einem zeitgenössischen Rockabilly/Rock´n´Roll-Setting.
"Violent Days" ist konsequent in schwarz/weiß-gedreht, denn die Zeit ist für die Figuren in den 60ern stehen geblieben. Mit Riesentolle, Jeans mit Schlag und gealtigen Koteletten trotzen sie dem Zeitgeist und machen "ihr Ding", eben den Rock´n´Roll. Bloß spielt der Film nicht in den USA der 50er oder 60er Jahren, sondern in einem ziemlich zeitgenössichen Frankreich. Das stellt natürlich die Verlorenheit und Unstimmigkeit dieses Lebensstils heraus.
Die Handlung ist schnell erzählt: Eine Clique von vier Männern und eienr Frau verbindet nicht nur ihre Liebe zur 50er Jahre Rock-Musik, sondern auch ihre Hintergrund aus der Arbeiterklasse. Und ihr gewaltiges Aggresionspotenzial. An einem Wochenende fahren Sie zu einem Rock-Konzert nach LeHavre.
Sonst passiert nicht viel, in diesem Film, der sich oft an der Grenze zur Dokumentation bewegt, wenn bspw. nicht mehr klar ist, ob die Besucher des Konzertes Schauspieler sind oder nicht. Die Leere und Langsamkeit der Handlung wird konterkariert von dem ständigen Aggresionspotenzial der Figuren und eben der guten, schnellen, schönen Musik. Das alles passt nicht wirklich zusammen, und genau das zeigt der Film auch in eindringlichen Bildern, die auch uns Zuschauer nicht vor dieser Leere und Langeweile bewahren. Denn es passiert nichts. Die fünf haben sich nichts zu sagen, sind ziemlich kaputte, verlorene Existenzen und der Konzertbesuch gerät beinah zur Freak-Show. Aber, und das ist die große Qualität des Filmes, werden die Figuren ernst genommen, werden zwar als Unsympathen dargestellt, aber nicht lächerlich gemacht, und es wird auch kein einfaches, positives Identifikationsmodell daneben gesetzt. Man ist einfach dabei, pseudo-dokumentarisch, bei einer Autofahrt von vier kaputten Existenzen, die eigentlich kein Leben leben, aber in ihrer Musik so tun können als ob.
Bei uns ist niemand eingeschlafen, ich war begeistert von diesem Film, Christian, Karen und Kathrin dagegen verwirrt bis gelangweilt. Daher Gesamturteil: zwiespältig.
Autor: dominik 19.02.05 11:35 | Kommentare (0)
11:00
Panorama: Ultranova von Bouli Lanners
Belgien, Frankreich 2004 Regie: Bouli Lanners * Drehbuch: Bouli Lanners * Kamera: Jean-Paul de Zaeytijd * Schnitt: Erwin Reyckaert * Darsteller: Vincent Lécuyer, Hélène De Reymaeker, Marie Du Bled

Die Hälfte des Film habe ich verschlafen. Kann ich jetzt trotzdem darüber schreiben? Immerhin beweist es wie glaubwürdig der Film war, in seinem Versuch Leere, Langeweile und Ausweglosigkeit in der belgischen Provinz zu zeigen. Hier passiert nichts. Und wenn etwas passiert, dann ist es traurig. Zeigen können die Menschen in dem Film ihre Traurigkeit allerdings nicht. Leere lässt auch Traurigkeit nicht wirklich zu. Wie die Menschen, so die Landschaft: es ist Winter, keine Farben, alles grau. Mir ist als ob ein Vampir dem Film die Farben entzogen hätte.
In seiner Trockenheit erinnert Ultranova mich ein wenig an Detlev Buck mit "Wir können auch anders" oder "Karniggels". Oder an Kaurismäki. Unterschied: es gibt nicht wirklich was zu lachen. Und: es entwickeln sich keine grossen Geschichten im kleinen Universum der Akteure. Sie sind keine Helden des Alltags. Sie können dem grauen Nebel der Bedeutungslosigkeit nicht entkommen. Ausbruchsversuche fahren gegen die Wand.
Vielleicht sollte ich mir den Film noch einmal im Sommer anschaun. Vormittags und nicht in der Spätvorstellung. Berlin im Winter scheint mir der denkbar ungünstigste Augenblick. Zu wenig Kontrast. Im Sommer würde ich aus dem Kino kommen, eine Brise würde wehen und mit einer leichten Traurigkeit würde ich nach Hause schlendern.
Autor: andreas 19.02.05 11:00 | Kommentare (0)
3:10
Forum: Mahiru no hoshizora (Starlit High Noon) von Nakagawa Yosuke
Japan 2005 * Regie/Buch: Nakagawa Yosuke Darsteller: Suzuki Kyoka, Wang Leehom, Kashii Yu Musik: Sawada Joji

Dieser Film ist nicht empfehlenswert, wenn man mit leerem Magen hingeht. Und tatsächlich geben die Produzenten zu, ja! wir hatten eigens dafür Food Production. Und einen Superkoch-Double. Denn der Hauptdarsteller Wang Leehom kann besser Musik machen als kochen: er ist im wahren Leben ein großer Popstar und Teenieschwarm in Ostasien. Seine Figur Lian Song ist ein Auftragskiller, der in Taipei „arbeitet“ und in Naha, Okinawa, der Muße nachgeht: kochen, schwimmen und Modellflugzeuge bauen. In diesem Refugium begegnet er Yukiko bei seinem wöchentlichen Besuch im Waschsalon und überwindet sich nach langem Beobachten, sie anzusprechen. Er lädt sie zum Essen ein, dem sie schließlich nach langem Zögern nachgibt. Doch soll er zurück nach Taipei. Man will ihn an das verfeindete Triadenlager zum Zeichen der Wiedergutmachung opfern, da Lian den gegnerischen Boss im Auftrag umgebracht hatte. Lian schreibt einen Brief an Yukiko, sie solle sich entscheiden: zum Flughafen kommen, dann würde er in Naha bleiben, oder er würde für immer nach Taipei gehen. Diesen Brief vertraut er der jungen Frau an, an die er täglich im Schwimmbad vorbeigeht – sie ist dort eine Angestellte, die ihn heimlich von ferne bewundert. Eifersüchtig schmeißt sie den Brief weg.
Im Film fällt entgegen unseren Erwartungen kein einziger Schuss. Er ist ruhig und voller Bilder der üppigen subtropischen Landschaft Okinawas. Samtige Brisen, warmes Sonnenlicht, leises Klingeln von Windspielen und das Meer, kein Wunder, dass Protagonist Lian sich hier in seinem Gaijin-Haus wohlfühlt (hier sind US Militärbasen und extra für sie errichtete Häuser). Er wirkt naiv und jungenhaft, fast tollpatschig, verliehen durch seine für asiatische Verhältnisse große Statur, und ist ein Träumer. Er will einmal in der Mittagssonne die Sterne sehen. Denn man erzählt sich, auf dem Himalaya wäre dies möglich. Gleichzeitig schwimmt er wie ein Berufssportler, geht geschmeidig gefährlichen Situationen aus dem Weg. Suzuki Kyokas Rolle spricht wenig. Ihre Mimik ist subtil, die Figur ist verhalten, und trotzdem erkennen wir die tiefe Trauer in einem einzigen Blick. Wir sehen eine leise Andeutung von Skepsis in ihrem Gesicht, als sie das taiwanesische Essen probieren soll, und den plötzlichen Umschwung in ein erstaunt begeistertes Aufleuchten. Sie ist im Gegensatz zu Wang Leehom eine ausgebildete Schauspielerin, die wir aus Radio no jikan kennen und in Blood and Bones mit Beat Takeshi sehen werden.
Der Regisseur nimmt sich viel Zeit, diese Geschichte zu erzählen. Sehnsüchtige Landschaftsbilder und unterschwellig erotische Essensszenen, bloß nichts überstürzen oder offen ansprechen. Kleine Gesten entscheiden. Ich muss die fantastische Musik von Joji Sawada erwähnen, endlich wieder Filmmusik: mit richtigen Instrumenten und richtiger Komposition. Gezielt eingesetzt, ohne zu sehr von der Handlung abzulenken.
Ein großer Wermutstropfen bleibt, denn wie soll dieser Film synchronisiert werden? Mir wurde erst bei einer Publikumsfrage bewusst, dass kaum ein Zuschauer merken konnte, wie Lian seine Monologe auf Mandarin führt und mit Bravour ins Japanische wechselt, wenn er sich mit Yukiko unterhält. In dem Film ist es völlig normal zwischen den Sprachen zu wechseln (und sie sind sich in keinster Weise ähnlich, auch nicht untereinander mit kantonesisch oder koreanisch). Es zeigt eine Form von „inter-connectedness“ in Ost- und Südostasien und erzeugt eine ganz eigene Atmosphäre, die mittlerweile in mehreren Filmen vorkommt – Fulltime Killer auf japanisch, kantonesisch, mandarin und etwas englisch, Comrades - Almost a Love Story auf kantonesisch, mandarin und englisch usw.
Nun denn, wem asiatische Sprachübungen zu umständlich sind, der soll sich einfach nur auf die schönen Bilder konzentrieren und sich den Duft vom Essen vorstellen.
Autor: haiwen 19.02.05 03:10 | Kommentare (0)